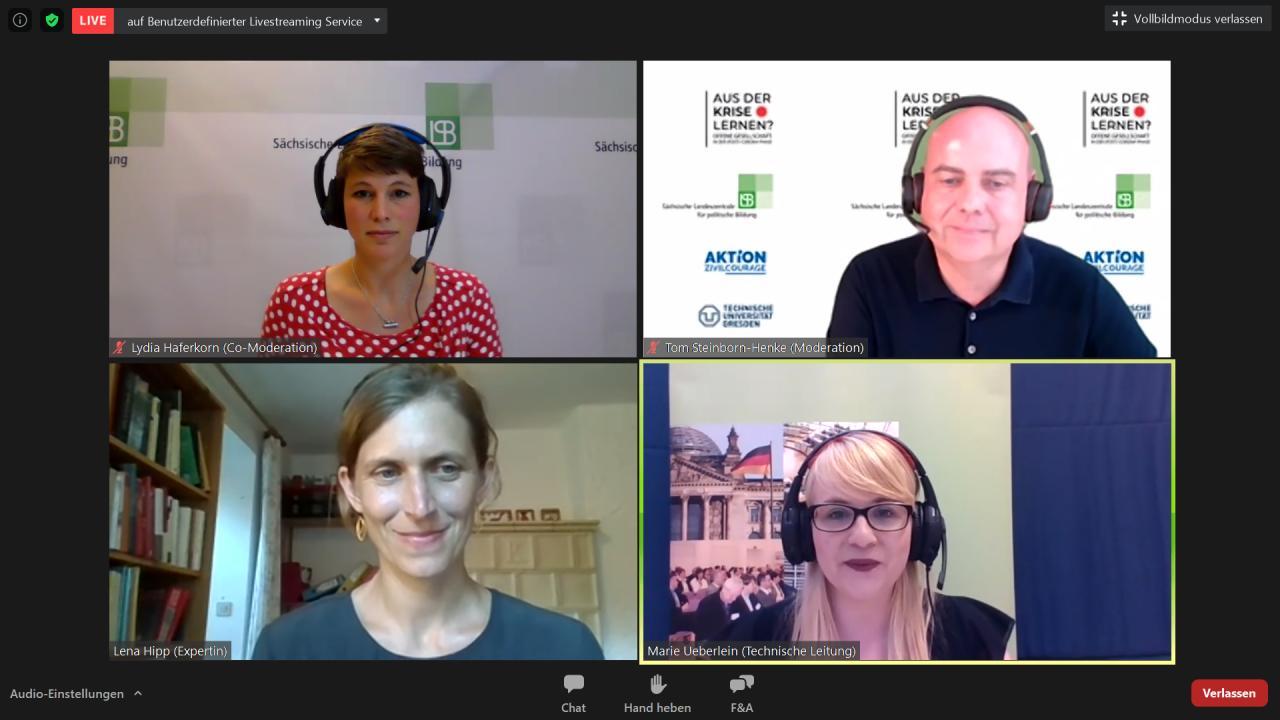Die Familie sollte eigentlich ein Schutzraum sein, sagt Nina Weimann-Sandig. In der Coronakrise sei das schlagartig weggebrochen. "Arbeit und Homeschooling wurden am Esstisch gemacht, es gab keine geregelten Arbeitszeiten mehr, das heißt: Arbeit und Familie sind ineinandergeflossen." Die Professorin für Empirische Sozialforschung und Soziologie lehrt und forscht an der Evangelischen Hochschule Dresden. "Wir haben in der Coronakrise gemerkt, dass wir eine Pluralität von Familienformen haben", sagt sie in der Bürgerdebatte am 30. Juni, "Held der Arbeit und Heldin des Haushalts: Dreht Corona die Zeit zurück?" war die Frage des Abends. Das bedeute kein Aussterben der sogenannten "Kernfamilie", sondern vielmehr eine gewinnbringende Akzeptanz vielfältiger Familienmodelle. "Aber wir sehen, dass nicht alle Familienformen auch politischen Rückhalt bekommen." Besonders extrem seien die Alleinerziehenden gefordert gewesen, deren ganzes Modell aus Berufstätigkeit und Kindererziehung ins Wanken geraten sei: "Die Krise hat gezeigt, dass der Schutzgrad von alleinerziehenden Familienmodellen nicht ausreichend ist", so Weimann-Sandig.
Die Krise habe so die systematischen Zwänge, in denen sich Familien heute ohnehin schon bewegen, noch mal eklatant verdichtet. Weimann-Sandig spricht von einer "doppelten Entgrenzung" von Familien: "Auf der einen Seite muss ich alle Anforderungen der Arbeitswelt unter den Hut bringen, und auf der anderen Seite ist Familie heute nichts Selbstverständliches mehr, sondern eine Herstellungsleistung." Wer wie viel Sorgearbeit übernehme, wer berufliche Einschränkungen hinnehme und wer sich weiterbilde, müsse permanent neu verhandelt werden. Hinzu komme die sogenannte "verantwortete Elternschaft": Eltern fühlen sich heute sehr viel mehr verantwortlich dafür, dass sie ihren Kindern gute Bildungs- und Aufstiegschancen aufzeigen.
Die Krise habe diese Doppelbelastung weiter verschärft und in die Wohnungen getragen. Wie die Familien das stemmen, hängt oftmals davon ab, wie sich die Eltern die Hausarbeit und Kinderbetreuung aufteilen. Lena Hipp hat für das Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin die Zufriedenheit der Familien vor und während der Coronakrise untersucht und ihre Ergebnisse am 29. Juni dem Publikum vor- und zur Diskussion gestellt. Ihr Ergebnis: Frauen übernehmen durch die Krise drei Stunden mehr Haus- und Sorgearbeit als zuvor, Männer zwei Stunden mehr. Anteilsmäßig zu ihrem geringen Vorkrisenniveau hätten die Männer so nun zwar stark zugelegt. "Wir sehen aber, dass der Abstand, den die Frauen haben, weil sie vorher bereits mehr gemacht haben, beibehalten wurde, wenn sie ihn nicht sogar weiter ausgebaut haben", so Hipp. Auch die Größe der Wohnung spiele eine große Rolle in der Familienzufriedenheit: "Je größer die Wohnung, desto leichter waren die Lockdowns zu ertragen."
Insgesamt habe die schwierige Vereinbarkeit von Homeoffice und Kinderbetreuung die Zufriedenheit der Familien mit sich selbst, aber auch mit dem Leben insgesamt, in Mitleidenschaft gezogen. "Die Arbeitszufriedenheit von Müttern im Homeoffice lag schon zu Beginn des Lockdowns deutlich unter der von Vätern", so Hipp. Auch die Lebenszufriedenheit sei bei den Müttern während der Krise stärker abgefallen. Das spiegeln auch die Zuschauerfragen wieder: Besonders der qualitative Anspruch an Arbeit und Kindererziehung gleichermaßen leide in Zeiten von Homeoffice und Kitaschließungen. Weimann-Sandig und Hipp hoffen daher beide, dass die Wertschätzung von bezahlter wie unbezahlter Sorgearbeit durch die Krise wächst – finanziell wie politisch.
Ein Mitschnitt der Diskussion vom 29. Juni ist auf unserem YouTube Kanal verfügbar.
Bis zum 17. Juli veranstaltet die SLpB Online-Bürgerdebatten, in der die Menschen im Freistaat aufgerufen sind, mit Fachleuten über die Folgen der Coronakrise zu diskutieren. Weitere Informationen finden Sie hier.